

Aus der Presse/SWR
Würth verliert vor dem Landesarbeitsgericht – Kündigung wegen Unterschriftenaktion unwirksam
Die Adolf Würth GmbH mit Sitz in Künzelsau (Hohenlohekreis) ist mit ihrer Berufung gescheitert: Das Landesarbeitsgericht (LAG) Stuttgart hat entschieden, dass die Kündigung eines Mitarbeiters rechtswidrig ist. Geklagt hatte der Logistik-Mitarbeiter Jürgen Fischer. Der Konzern warf ihm vor, Kolleginnen und Kollegen über den Inhalt einer Unterschriftenaktion getäuscht zu haben. Die Richter folgten dieser Darstellung nicht – ebenso wenig wie zuvor bereits das Arbeitsgericht Heilbronn. Dennoch ist der Streit nicht ausgefochten: Jürgen Fischer will seinen Arbeitsplatz zurück.
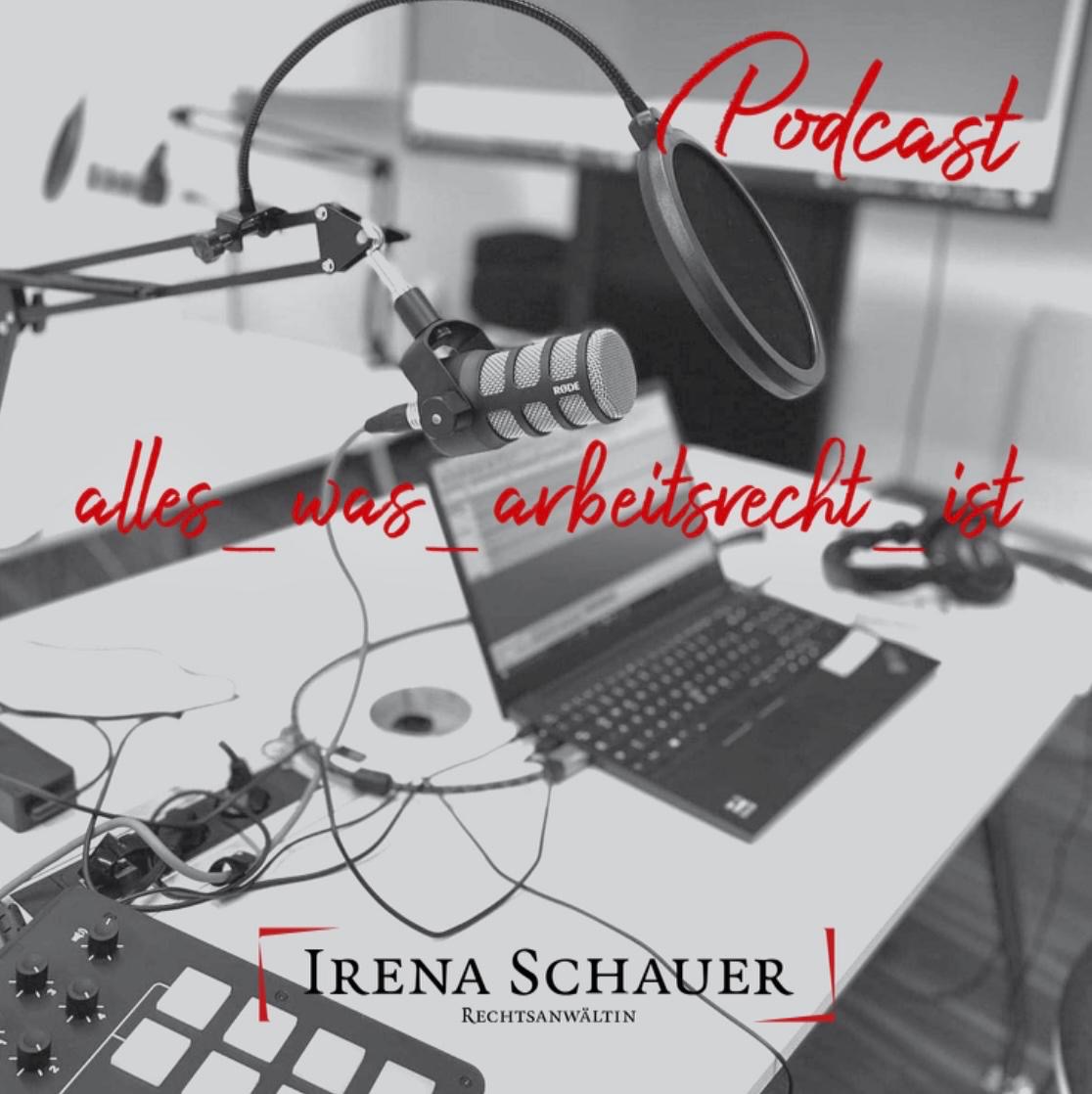
Der Podcast von Rechtsanwältin Irena Schauer: „alles_was_arbeitsrecht_ist“
Arbeitsrecht dominiert einen der größten Bereiche unseres Lebens: unseren Beruf, unsere Berufung, unser Einkommen und letztendlich auch wie lebenswert der Teil des Lebens ist, der nicht Arbeitsleben ist.
Als Team IG Metall bei Würth freuen wir uns sehr, dass wir eine interessante Podcast-Reihe präsentieren dürfen. Vielen Dank an Rechtsanwältin Irena Schauer für die Zusammenarbeit. Wir starten mir einer spannenden Episode: „Best of Beleidigung oder Meinungsfreiheit im Arbeitsverhältnis“ – Grundrecht oder fristloser Kündigungsgrund?
Den Podcast gibt es auch auf Apple Podcast und Google Podcast.

Darf ich über den Chef lästern?
Wer kennt das nicht? In der Kantine oder nach der Arbeit wird im Kollegenkreis gelegentlich ordentlich Dampf über den Chef oder andere Arbeitskolleginnen und -kollegen abgelassen. Hier erfährst Du, wann Lästermäuler mit rechtlichen Sanktionen wie Abmahnung oder Kündigung rechnen müssen.
Ob Konflikte im Betrieb oder einfach nur Meinungsäußerungen – lästern im Job gehört oft zum Arbeitsalltag und wirkt befreiend. Aber Achtung: Das Arbeitsverhältnis ist kein Ort der Neutralität. Grundsätzlich hat jeder Mensch – auch im Arbeitsleben – das Recht auf freie Meinungsäußerung (Artikel 5 Grundgesetz). Das Grundrecht gilt jedoch nicht uneingeschränkt. Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer schuldet dem Arbeitgeber ein Mindestmaß an Loyalität, die hier arbeitsvertragliche Grenzen setzt.
In der Öffentlichkeit und im Internet: Aufpassen!
So entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG): Grobe Beleidigungen des Arbeitgebers, seiner Vertreterinnen und Vertreter sowie Repräsentantinnen und Repräsentanten oder von Kolleginnen und Kollegen, die nach Form und Inhalt eine erhebliche Ehrverletzung für den Betroffenen bedeuten, stellen einen gewichtigen Verstoß gegen die Pflicht zur Rücksichtnahme auf die berechtigten Interessen des Arbeitgebers dar und können eine fristlose Kündigung rechtfertigen.
Entsprechendes gilt für bewusst wahrheitswidrig aufgestellte Tatsachenbehauptungen – etwa bei übler Nachrede. Insbesondere bei Schmähkritik und Formalbeleidigungen kann sich eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter nicht auf ihr bzw. sein Recht auf freie Meinungsäußerung berufen.
Achtung: Das gilt auch für Äußerungen und Lästereien über Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzte oder den Betrieb in sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram, Twitter oder Xing. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht darauf an, ob Gesagtes wertvoll, polemisch unsinnig oder sachlich ist, sondern ob es noch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist.
Äußerungen im privaten Umfeld
Doch es muss differenziert werden, ob sich Beschäftigte im privaten oder öffentlichen Umfeld äußern. Das BAG hat bereits 1965 zum Thema „Meinungsfreiheit unter Kollegen“ klar Stellung genommen: Solche anfechtbaren oder doch jedenfalls unvorsichtigen Äußerungen werden im Kreise der Kolleginnen und Kollegen in der sicheren Erwartung getan, dass sie nicht über den Kreis der Gesprächsteilnehmenden hinausdringen. Wer an diesem Gespräch teilnimmt, unterwirft sich den stillschweigenden Regeln menschlicher Gemeinschaften, die Äußerungen der Gesprächsrunde nicht an andere Stellen weiterzugeben, so die Richter.
Bis heute hat sich wenig an diesen „stillschweigenden Regeln menschlicher Gemeinschaft“ geändert. Äußerungen in persönlichen Gesprächen – auch unter Kolleginnen und Kollegen – sind Ausdruck der Persönlichkeit und stehen damit unter dem Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Und zwar selbst dann, wenn die Bemerkungen gegenüber Außenstehenden ehrverletzend sind.
Die oder der Einzelne darf darauf vertrauen, dass getroffene Aussagen, die den Betriebsfrieden stören oder das Vertrauensverhältnis zum Arbeitgeber belasten könnten, nicht nach außen dringen.
Wissenswertes zur Gehaltsabrechnung
Im Arbeitsverhältnis dreht sich alles um den Austausch von Geld gegen Arbeit. Beschäftigte erbringen ihre vertraglich vereinbarte Arbeitsleistung, während Arbeitgeber im Gegenzug das vereinbarte Gehalt regelmäßig und pünktlich zahlen. Das ist dabei zu beachten.
Darum geht es
1. Im Arbeitsverhältnis tauschen Beschäftigte ihre Arbeitsleistung gegen das vertraglich vereinbarte Entgelt.
2. Das Entgelt wird als Bruttoentgelt vereinbart, von dem Sozialversicherungsbeiträge und Steuern abgezogen werden.
3. Arbeitgeber sind verpflichtet, den Beschäftigten regelmäßig eine Entgeltabrechnung zu erteilen, damit diese die Abzüge nachvollziehen können.
Die Hauptleistungspflichten im Arbeitsverhältnis sind – kurz gesprochen – Geld gegen Arbeit. Das heißt, die Beschäftigten schulden ihre Tätigkeit in dem zeitlichen Umfang, die vertraglich vereinbart ist. Die Arbeitgeber müssen im Gegenzug das hierfür vereinbarte Entgelt turnusgemäß, regelmäßig monatlich, zahlen. Das ergibt sich aus § 611a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Doch das vertraglich vereinbarte Entgelt wird als Bruttoentgelt vereinbart, d. h., es fallen Sozialversicherungsbeiträge und Einkommenssteuer an. Dabei sind die Arbeitgeber verpflichtet, diese an die Krankenkasse bzw. an das Finanzamt abzuführen, § 28e Sozialgesetzbuch 4. Buch (SGB IV) bzw. § 41a Einkommenssteuergesetz (EStG). Das führt dazu, dass die Beschäftigten nicht den vereinbarten Bruttobetrag ausgezahlt bekommen, sondern einen davon abweichenden Nettobetrag. Um den Beschäftigten die Möglichkeit zu geben, die Richtigkeit der Abrechnung des vereinbarten Bruttoentgelts zu prüfen, müssen Arbeitgeber den Beschäftigten regelmäßig eine Entgeltabrechnung erteilen. Diese Pflicht ergibt sich aus § 108 Gewerbeordnung (GewO).
Was muss die Entgeltabrechnung enthalten?
Welche Angaben eine Entgeltabrechnung enthalten muss, ergibt sich aus § 108 Abs. 1 GewO. Hiernach muss stets der Abrechnungszeitraum benannt werden. Das ist in der Regel ein konkreter Kalendermonat in einem bestimmten Kalenderjahr. Es kann aber auch ein anderer Zeitraum sein, etwa eine Arbeitswoche. Weiterer notwendiger Bestandteil ist das abgerechnete Arbeitsentgelt und dessen Zusammensetzung. Dabei sind Zuschläge und Zulagen konkret und jeweils nach Art und Höhe getrennt aufzuführen. Es reicht also nicht, einen Gesamtbetrag auszuweisen, sondern die Arbeitgeber müssen neben der monatlichen Grundvergütung hinsichtlich der Zuschläge und Zulagen deren Art und Höhe gesondert ausweisen. Es muss insbesondere erkennbar sein, wofür die einzelnen Entgeltbestandteile abgerechnet wurden. Es genügt z. B. nicht, einfach einen Betrag als „Mehrarbeitszuschlag“ zu beziffern; es muss zudem mindestens erkennbar sein, wie viele Mehrarbeitsstunden, für welchen Zeitraum und mit welchem Euro-Betrag pro Stunde dieser gewährt wurde. Diese Anforderung an die Konkretheit der Benennung gilt nicht nur für Zulagen und Zuschläge, sondern für alle Vergütungsbestandteile, also auch solche, die leistungsabhängig gezahlt werden, wie Provisionen oder Boni. Aber auch für solche, die monatlich verstetigt gezahlt werden: Zuschüsse zu Fahrtkosten, geldwerte Vorteile für die private Nutzung eines Firmen-PKW u.Ä. Aufgenommen werden müssen auch alle Einmalzahlungen, wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld oder tarifliche Einmalzahlungen, und zwar jeweils in dem Monat, in dem sie gezahlt werden. Weiter muss die Abrechnung dezidiert die Höhe und die Art der Abzüge aufführen. Hierunter sind die Beiträge zur Sozialversicherung und die abgeführte Einkommenssteuer zu nennen. Benannt werden müssen auch Beträge, die die Beschäftigten im Wege der Entgeltumwandlung für die betriebliche Altersversorgung aufwenden, oder Beträge, die wegen einer Pfändung an einen Dritten abgeführt werden. Schließlich muss die Abrechnung ausdrücklich bereits geleistete Vorschüsse oder Abschlagszahlungen, die die Beschäftigten vorab bereits erhalten haben, ausweisen. Dies sind nur die Mindestangaben. Arbeitgeber sind frei darin, zusätzliche Angaben zu machen. So finden sich häufig Angaben zu den Urlaubstagen oder zum Stand der Arbeitszeitkonten in den Abrechnungen. Da hierzu keine Pflicht besteht, kann ein Beschäftigter nicht verlangen, dass solche Angaben regelmäßig anzugeben sind.
Aus dem Gesetz: §108 GewO
(1) Dem Arbeitnehmer ist bei Zahlung des Arbeitsentgelts eine Abrechnung in Textform zu erteilen. Die Abrechnung muss mindestens Angaben über Abrechnungszeitraum und Zusammensetzung des Arbeitsentgelts enthalten. Hinsichtlich der Zusammensetzung sind insbesondere Angaben über Art und Höhe der Zuschläge, Zulagen, sonstige Vergütungen, Art und Höhe der Abzüge, Abschlagszahlungen sowie Vorschüsse erforderlich.
(2) Die Verpflichtung zur Abrechnung entfällt, wenn sich die Angaben gegenüber der letzten ordnungsgemäßen Abrechnung nicht geändert haben.
Wie ist Entgeltabrechnung zu erteilen und wie muss sie übermittelt werden?
Für die Erteilung einer Entgeltbescheinigung genügt die Textform. Das bedeutet, dass diese nicht unterschrieben sein muss. Vielmehr muss die Bescheinigung so zur Verfügung gestellt werden, dass sie von den Beschäftigten dauerhaft aufbewahrt oder gespeichert werden kann, § 126a BGB. In vielen Unternehmen wird die Entgeltbescheinigung mittlerweile digital erstellt und den Beschäftigten übermittelt. Häufig werden diese gar nicht mehr verschickt, sondern im Wege des sogenannten Self-Services auf einem von den Arbeitgebern bestimmten Mitarbeiter-Portal hinterlegt. Dabei ist zu beachten, dass eine solche Vorgehensweise nur zulässig ist, wenn die Beschäftigten vorher ausdrücklich und freiwillig ihre Zustimmung hierzu erteilen. Wichtig ist, dass eine solche Zustimmung nicht durch eine Betriebsvereinbarung ersetzt werden kann, denn anderenfalls würden die Betriebsparteien in ein gesetzlich verbrieftes Recht der Beschäftigten eingreifen, dass darin besteht, dass diese selbst entscheiden können, auf welches elektronische Medium – z. B. eigenes privates E-Mail-Postfach – die digitale Abrechnung übermittelt werden soll.1

Wann ist sie zu erteilen?
Die Entgeltabrechnung ist vom Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Zahlung des Entgelts zu erteilen, d. h., die Abrechnung muss vorliegen, wenn die Beschäftigten ihre Vergütung erhalten. In der Regel dann, wenn die Vergütung dem Konto gutgeschrieben wird. Erfolgt die Erteilung der Abrechnung vor der Zahlung, wird diese nicht unwirksam, soweit der ausgewiesene Betrag mit dem angewiesenen übereinstimmt. Die Entgeltabrechnung ist regelmäßig für jeden einzelnen Abrechnungszeitraum, also pro Kalendermonat, zu erteilen. Nur dann, wenn sich gegenüber dem vorherigen Abrechnungsmonat keine Differenz ergibt, kann auf eine Abrechnung verzichtet werden, § 108 Abs. 2 GewO.
Welche Wirkung hat sie? Und was bedeutet das für die Verfolgung von Vergütungsansprüchen?
Die Entgeltabrechnung dient allein dazu, den Beschäftigten mitzuteilen, wie die Arbeitgeber den ausgezahlten Nettobetrag errechnet haben. Sie dient damit einzig der Information der Beschäftigten über die vorgenommene Abrechnung; sie soll gleichzeitig den Abrechnungsvorgang transparent darstellen, damit die Beschäftigten erkennen, warum sie gerade den Nettobetrag erhalten haben.2 Sie ist keine Willenserklärung, sondern eine Wissenserklärung.3 Damit ist die Entgeltabrechnung keine Erklärung der Arbeitgeber, mit der sie sich rechtlich zu den einzelnen dort enthaltenen Ansprüchen verpflichten; die Beschäftigten können daraus gerade nicht ableiten, dass die Arbeitgeber sich verpflichten, die ausgewiesenen Ansprüche auch tatsächlich gewähren zu wollen.4 Die Abrechnung gibt lediglich Auskunft darüber, auf welcher Grundlage der ausgezahlte Betrag ermittelt wurde. Das bedeutet gleichzeitig, dass die Abrechnung für die Beschäftigten nicht die Rechtsgrundlage für Zahlungsklagen für nicht oder zu wenig gezahlte Vergütung sein kann, denn die Abrechnung ist keine Anspruchsgrundlage für die Zahlung.5 Wenn also ein Arbeitgeber den Beschäftigten zu wenig Entgelt oder gar keines zahlt, können sich die Beschäftigten nicht auf erteilte Entgeltabrechnungen berufen. Sie müssen vielmehr die arbeitsvertragliche Grundlage für den Zahlungsanspruch darlegen, also die arbeitsvertragliche oder tarifvertragliche Regelung benennen; es muss also die Regelung benannt werden, aus der sich die Höhe der Grundvergütung oder einer Einmalzahlung ergibt. Häufig müssen zusätzlich noch Angaben zum zeitlichen Umfang gemacht werden, etwa, wenn Mehrarbeitsvergütung geltend gemacht wird. Die Entgeltabrechnungen der Vergangenheit können bei der Darlegung solcher Ansprüche aber eine Hilfe sein, um die bisherige Zahlung belegen zu können. Da die Abrechnung keine Willens-, sondern eine Wissensbekundung ist, sind Arbeitgeber nicht daran gehindert, Änderungen an den dort erteilten Angaben zu machen oder die Abrechnung zu korrigieren, wenn sie der Meinung sind, dass die vorangegangene Abrechnung fehlerhaft war. So können Arbeitgeber ggf. die Angabe zu den Urlaubsansprüchen verändern, wenn sie der Meinung sind, dass die bisherigen Angaben fehlerhaft waren.6 Sie können auch das Entgelt ganz oder teilweise neu berechnen, wenn sie Fehler in der Abrechnung erkannt haben; dann müssen sie diese Korrekturen durch eine neue Abrechnung aufzeigen. Häufig erfolgt dies durch Nachberechnungen für die vergangenen Monate. Da die Entgeltabrechnung keine Willenserklärung ist, ist sie kein taugliches Instrument für die Arbeitgeber, die vertraglichen Vereinbarungen über das Entgelt der Beschäftigten zu ändern. Soll sich künftig die Zusammensetzung des Entgelts ändern, genügt es nicht, dass die Arbeitgeber dies einfach in der Entgeltabrechnung umsetzen. Sie müssen vielmehr die arbeitsvertragliche Grundlage ändern, indem sie z. B. eine Änderungskündigung aussprechen oder von einem vertraglich wirksam vereinbarten Widerrufs- oder Anpassungsrecht Gebrauch machen. Haben Beschäftigte z. B. Anspruch auf eine übertarifliche anrechenbare Zulage, reicht es nicht, wenn Arbeitgeber bei einer Entgelterhöhung die Zulage einfach kürzen. Sie müssen den Beschäftigten dies entsprechend den arbeitsvertraglichen Vereinbarungen zuvor wirksam mitteilen.
Gut zu Wissen
Ausschlussfristen sind Regelungen in Arbeits- oder Tarifverträgen, die Beschäftigte dazu verpflichten, nicht oder zu wenig gezahlte Entgeltansprüche in einer bestimmten Frist gegenüber dem Arbeitgeber zunächst außergerichtlich und in vielen Fällen in einem zweiten Schritt gerichtlich geltend zu machen.
Muss die Entgeltabrechnung immer geprüft werden?
Auch wenn die Entgeltabrechnung lediglich Informationscharakter hat, sollten Beschäftigte diese immer genau prüfen, denn sie gibt Auskunft darüber, auf welcher Grundlage die Arbeitgeber die Abrechnung vorgenommen haben. Ergeben sich hieraus Fehler, etwa weil die Arbeitgeber eine Einmalzahlung nicht ausgezahlt haben oder von einer zu geringen Zahlung ausgegangen sind, ist zumindest erkennbar, dass die Arbeitgeber nicht vertragskonform das Entgelt gezahlt haben. Die Beschäftigten können dann ihre nicht oder nicht vollständig gezahlten Entgeltbestandteile dezidiert benennen und gegenüber den Arbeitgebern geltend machen. Die Abrechnung dient in diesen Fällen dem Nachweis, dass der geltend gemachte Anspruch gerade nicht bzw. nicht vollständig erfüllt wurde. Die unmittelbare Prüfung ist auch deshalb wichtig, weil in vielen Arbeitsverträgen und auch in einigen Tarifverträgen sogenannte Ausschlussfristen vereinbart sind, die mit dem Zeitpunkt der Erteilung der Abrechnung zu laufen beginnen.



Aus dem Arbeitsgericht
Urteil: Urlaub verjährt nicht einfach
Der Fall: Die Arbeitnehmerin war vom 1. November 1996 bis zum 31. Juli 2017 als Steuerfachangestellte und Bilanzbuchhalterin beschäftigt. Nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zahlte der Arbeitgeber zur Abgeltung von 14 Urlaubstagen 3.201,38 Euro brutto. Der weitergehenden Forderung der Arbeitnehmerin, Urlaub im Umfang von 101 Arbeitstagen aus den Vorjahren abzugelten, kam der Arbeitgeber nicht nach. Die dagegen gerichtete Klage der Arbeitnehmerin hatte Erfolg.
Das Bundesarbeitsgericht: Die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren beginnt nicht zwangsläufig mit Ende des Urlaubsjahres, sondern erst mit dem Schluss des Jahres, in dem der Arbeitgeber den Arbeitnehmer über seinen konkreten Urlaubsanspruch und die Verfallfristen belehrt und der Arbeitnehmer den Urlaub dennoch nicht genommen hat. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union gebührt in diesem Fall dem Schutz der Gesundheit des Arbeitnehmers Vorrang. Dazu gehört die Verpflichtung des Arbeitgebers, den Arbeitnehmer in die Lage zu versetzen, seinen Urlaubsanspruch wahrzunehmen.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 20. Dezember 2022 – 9 AZR 266/20
Urteil: Erreichbar, aber nicht in der Freizeit
Der Fall: Wegen kurzfristiger Dienstplanänderungen schickte der Arbeitgeber dem Notfallsanitäter außerhalb der Arbeitszeit Mitteilungen per SMS und per E-Mail. Ungeachtet dessen, meldete sich der Sanitäter jeweils wie ursprünglich geplant zu seinen Diensten. Der Arbeitgeber wertete das Verhalten seines Angestellten als unentschuldigtes Fehlen und erteilte ihm zunächst eine Ermahnung und dann eine Abmahnung. Die dagegen gerichtete Klage hatte Erfolg.
Das Landesarbeitsgericht: Der Arbeitgeber musste damit rechnen, dass der Sanitäter die ihm geschickte SMS erst mit Beginn seines Dienstes zur Kenntnis nahm. Zu diesem Zeitpunkt war der Arbeitnehmer verpflichtet, seiner Arbeit nachzugehen und dazu gehört auch, die in seiner Freizeit bei ihm eingegangenen dienstlichen Nachrichten des Arbeitgebers zu lesen. Der Arbeitnehmer ist darüber hinaus nicht verpflichtet, sich in seiner Freizeit zu erkundigen, ob sein Dienstplan geändert worden ist. Der Arbeitnehmer hat sich nicht treuwidrig verhalten. Das Recht auf Nichterreichbarkeit dient neben dem Gesundheitsschutz des Arbeitnehmers auch dem Persönlichkeitsschutz. Es gehört zu den vornehmsten Persönlichkeitsrechten, dass ein Mensch selbst entscheidet, für wen er/sie in dieser Zeit erreichbar sein will oder nicht.
Landesarbeitsrecht Schleswig-Holstein, Urteil vom 27. September 2022 – 1 Sa 39 öD/22
Hast du das gewusst?
Urteil: Sturz beim Kaffee-Holen ist Arbeitsunfall
Der Fall: Die Verwaltungsangestellte rutschte auf dem Weg zu dem im Sozialraum des Finanzamtes aufgestellten Getränkeautomaten auf nassem Boden aus und erlitt einen Lendenwirbelbruch. Ihr Antrag, dies als Arbeitsunfall anzuerkennen, wurde von der Unfallkasse mit der Begründung abgelehnt, der Versicherungsschutz ende regelmäßig mit dem Durchschreiten der Kantinentür. Die dagegen gerichtete Klage hatte Erfolg. Das Landessozialgericht: Der Sturz ist als Arbeitsunfall anzuerkennen.
Das Landesarbeitsgericht: Der Sturz ist als Arbeitsunfall anzuerkennen. Das Zurücklegen des Weges hat im inneren Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit der Angestellten gestanden. Ein Beschäftigter ist auf dem Weg, um sich Nahrungsmittel zum alsbaldigen Verzehr am Arbeitsplatz zu besorgen, grundsätzlich gesetzlich unfallversichert. Beim Kauf von Lebensmitteln für den häuslichen Bereich sind die insoweit zurückgelegten Wege hingegen nicht versichert. Ebenso ist die Nahrungsaufnahme selbst dem privaten Lebensbereich zuzurechnen und daher grundsätzlich nicht in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert. Der Pausen- oder Freizeitraum gehörte auch in den Verantwortungsbereich des Arbeitgebers.
Hessisches Landessozialgericht, Urteil vom 7. Februar 2023 – L 3 U 202/21

Oft wird ein Arbeitsunfall nicht anerkannt…
Wir sind Experten in Sachen Arbeit. Wir kennen die Entwicklung in den Branchen und Betrieben. Deshalb werden unsere Mitglieder fundiert und kompetent beraten und vertreten. Von Prüfung der Arbeitsverträge, über Auseinandersetzungen um Lohnabrechnungen bis hin zur Prozessvertretung vor Gerichten oder Behörden. Auch bei Streitigkeiten um Schadensersatz oder Schmerzensgeld im Zusammenhang mit einem Arbeitsunfall (ausgenommen Wegeunfälle) erhalten Mitglieder Unterstützung und Beratung. Ebenso bei Auseinandersetzungen um prüfungsrelevante Angelegenheiten entstehen in der Regel für Mitglieder keine Kosten.
Der Rechtsschutz der IG Metall umfasst zum Beispiel:
§ Arbeitsrecht
▸ Arbeitsentgelt
▸ Kündigung
▸ Urlaub und Urlaubsgeld
▸ Eingruppierung
§ Betriebliche Altersversorgung
§ Sozialrecht
▸ Rentenversicherung
▸ Arbeitslosenversicherung
▸ Streitigkeiten um Arbeitslosengeld II
▸ gesetzliche Unfallversicherung
▸ gesetzliche Krankenversicherung
▸ Feststellung der Schwerbehinderung
§ Steuerrecht (wenn der Streit das Arbeitsverhältnis betrifft)
▸ z.B. steuermindernde Anerkennung der Berufskleidung oder Fahrten zum Arbeitsplatz

IGM: Es gibt Beschäftigte, die auf einen Gewerkschaftsbeitrag oder eine Arbeitsrechtsschutzversicherung verzichten. Rentiert sich so etwas überhaupt?
JM: Ich empfehle Beschäftigten, sowohl Mitglied in der im Betrieb vertretenen Gewerkschaft zu werden, als auch eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft ist wichtig, da nur gemeinsam in einer Organisation dafür gekämpft werden kann, dass sich langfristig die Löhne und Gehälter weiterentwickeln und die Arbeitsbedingungen angemessen sind. Ein Vergleich zeigt, dass in den Branchen, in den Gewerkschaften stark sind und viele Tarifverträge erkämpft haben, auch in den Betrieben, die nicht tarifgebunden sind, ordentliche Löhne und Geh-älter gezahlt werden und die Arbeitsbedingungen passen. Es ist deshalb auch in einem tariflosen Betrieb wichtig, in die Gewerkschaft einzutreten, da damit die Handlungsmöglichkeiten der Gewerkschaft insgesamt verbessert werden. Dies ist letztendlich zum Wohle aller Beschäftigten in der Branche. Zum Abschluss einer Rechtsschutzversicherung rate ich aus anderem Grund. Ein Rechtsstreit mit dem Arbeitgeber, z. B. wegen einer unberechtigten Kündigung, kann schnell sehr teuer werden. Gegen dieses Risiko sollte sich jede/jeder absichern, der in einem Arbeitsverhältnis steht. Es wäre doch sehr bedauerlich, wenn man sich gegen Ungerechtigkeiten nicht zur Wehr setzen könnte, nur weil man es sich nicht leisten kann
IGM: Was ist der Unterschied zwischen Kollektiv- und Individualarbeitsrecht und wo gibt es noch Probleme?
JM: Das individuelle Arbeitsrecht regelt die Rechte und Pflichten zwischen Arbeitgeber und seinen einzelnen Beschäftigten. Beim kollektiven Arbeitsrecht geht es um die Rechte und Pflichten zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, die im Betriebsverfassungsgesetz geregelt sind. Das Betriebsverfassungsgesetz verpflichtet den Arbeitgeber, in vielen betrieblichen Fragen den Betriebsrat vorab zu beteiligen, sich mit dem Betriebsrat zu beraten oder sogar die Zustimmung des Betriebsrats zu bestimmten Maßnahmen einzuholen. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, Arbeitgeber dazu zu bringen, diese Verpflichtungen gegenüber den Betriebsräten auch einzuhalten. Es ist schon erstaunlich: Kein Geschäftsführer würde bei Rot über die Ampel fahren, weil es in der Straßenverkehrsordnung so geregelt ist und weil man dafür ein Bußgeld bezahlen muss. Die gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber Betriebsräten aus dem Betriebsverfassungsgesetz, das in der Rechtsordnung höher steht, werden jedoch regelmäßig missachtet, weil sie als lästig empfunden werden.

5 Fragen an Arbeitsrechtanwalt Jürgen Markowski
Die Arbeitswelt wird komplizierter. Immer mehr komplexe Themen und Probleme bereiten den Beschäftigten Sorgen. Konzerne und auch Familienunternehmen beschäftigen ganze Armeen von Rechtsanwälten. Aber auch den Angestellten und Arbeitern wird geholfen. Wie zum Beispiel von Jürgen Markowski und seinem Team. Wir haben ihn befragt.
IGM: Gleichmal vorweg: Warum hast Du Dich für die Seite der Arbeitnehmer im Arbeitsrecht entschieden?
JM: Ich bin davon überzeugt, dass die Arbeitswelt von einem grundlegenden Interessengegensatz bestimmt wird. Auf der einen Seite stehen die Interessen der Arbeitgeber, also die Interessen der Unternehmer und der Anteilseigner, und auf der an-deren Seite stehen die Interessen der Belegschaft, faire Löhne für die Arbeit zu erhalten, gute Arbeitsbedingungen zu haben und sichere verlässliche Arbeitsplätze. Das Arbeitsrecht versucht, einen Ausgleich zwischen diesen Interessen herzustellen. Ich bin auf Arbeitnehmerseite als Anwalt tätig, weil ich die Beschäftigten darin unterstützen will, ihre Rechte auch durchzusetzen. Deshalb berate ich auch Betriebsräte in ihren Auseinandersetzungen mit dem Arbeitgeber sowohl in direkten Verhandlungen als auch in gerichtlichen Auseinandersetzungen. Nur wenn die Arbeitgeber ihre eigenen Pflichten wahrnehmen und die Rechte der Beschäftigten respektieren, kann ein vernünftiger Ausgleich der Interessen erfolgen. Dabei will ich die Arbeitnehmerseite unterstützen.
IGM: Was sind die häufigsten Themen, mit denen Du und Dein Team konfrontiert werdet?
JM: Wir beraten die Betriebsräte vieler Unternehmen. Hier geht es häufig um die Fragen der innerbetrieblichen Gerechtigkeit. Wie muss eine ausgewogene betriebliche Arbeitszeitgestaltung aussehen, die einerseits den betrieblichen Interessen gerecht wird, und andererseits aber auch den Beschäftigten die Möglichkeit gibt, ein gutes privates Leben zu führen? Wie schützen wir die Beschäftigten vor maßloser Überwachung durch technische Systeme? Wie können Betriebsräte den Einsatz künstlicher Intelligenz so gestalten, dass der Einsatz dieser neuen Technologie nicht zulasten der Beschäftigten geht? Weitere Stichworte in dem Kontext sind die Beratung von Betriebsräten bei Personalabbau und Umstrukturierungen, Einführung von Vergütungsmodellen, um innerbetriebliche Lohngerechtigkeit zu erreichen, und betrieblicher Gesundheitsschutz. Bei der Beratung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und deren rechtlicher Vertretung steht natürlich an erster Stelle der Schutz vor unberechtigten Kündigungen und Abmahnungen. Je schwieriger die wirtschaftliche Situation wird, desto mehr haben wir auch mit Lohnzahlungsklagen zu tun oder mit der Einhaltung vertraglicher Zusicherungen im Vergütungsbereich (nicht gewährte Prämien, Entzug von Dienstfahrzeugen und Ähnliches).
IGM: Was sind die künftigen Herausforderungen an das Arbeitsrecht?
JM: Häufig werden die Regeln des Arbeitsrechts als Hemmschuh für eine erfolgreiche Transformation der Wirtschaft dargestellt. So als ob nur alle Schutzregeln für die Beschäftigten abgeschafft werden müssten und dann würde der Markt schon alles zum Besten regeln. Daran glaube ich nicht. Die Transformation der Arbeitswelt wird nur gelingen, wenn es verlässliche Spielregeln gibt, auf die sich die Akteure verlassen können. Das moderne Arbeitsrecht muss in gleichem Maße den Beschäftigten in den Betrieben einen verlässlichen Schutz geben, damit sie auch an den Entwicklungen teilhaben können. Dazu gehören sicherlich verlässliche zeitliche Arbeitszeitregelungen, Rahmenbedingungen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes und des Schutzes vor psychischen Fehlbelastungen durch ständige Überforderung, ein effektiver Schutz vor unberechtigten Kündigungen und eine gerechte Vergütung. Dies ist kein Widerspruch zu der ständigen Forderung, das Arbeitsrecht müsse flexibler auf betriebliche Notwendigkeiten reagieren. Auch innerhalb von Regeln kann Flexibilität geschaffen werden .Flexibilität darf dabei aber nicht so verstanden werden, dass jede Verlässlichkeit verloren geht. Dann verlieren die Betriebe nämlich ihre Stabilität.
So läuft das Beschwerdeverfahren
Im betrieblichen Alltag kann es immer wieder vorkommen, dass Beschäftigte sich individuell benachteiligt, ungerecht oder unangemessen behandelt (diskriminiert) fühlen. Das müssen sie nicht hinnehmen, sondern können ihr Recht auf Beschwerde nutzen (§ 84 BetrVG). Der Arbeitgeber muss dafür eine im Betrieb zuständige Stelle betriebsöffentlich benennen (z. B. direkte Vorgesetzte, Personalabteilung, Sozialberatung, Gleichstellungsbeauftragte), die Beschwerden aus der Belegschaft entgegennimmt und behandelt.
Beschwerde an den Arbeitgeber
Hält der Arbeitgeber die eingegangene Beschwerde für berechtigt, muss er den Beschwerdegrund beseitigen (§ 84 Abs. 2 BetrVG) und den Beschwerdeführer darüber benachrichtigen. Das kann auch in mehreren Etappen geschehen, wenn der Vorgang länger anhält. Auch wenn der Arbeitgeber die Beschwerde für nicht gerechtfertigt hält, muss er den Beschwerdeführer informieren und seine Entscheidung begründen. Beschäftigte, die sich beschweren, können zu ihrer Unterstützung oder zur Vermittlung mit dem Arbeitgeber ein Betriebsratsmitglied ihres Vertrauens hinzuziehen.
Beschwerde an den Betriebsrat
Beschäftigte können sich mit ihrer Beschwerde ebenso an den Betriebsrat wenden (§ 85 Abs. 1 BetrVG). Hier kann es sich auch um eine kollektive Beschwerde mehrerer Beschäftigter handeln.

Betriebsräte können auch bei Abmahnungen unterstützen
LAG Köln – Beschluss – 06.08.2021 – 9 TaBV 26/21
Weil Betriebsräte kein Mitbestimmungsrecht beim Ausspruch von Abmahnungen haben, nehmen sie zuweilen irrtümlich an, Mitarbeiter hier nicht unterstützen zu können. Doch über einen Kniff ist dies möglich.
Gerade in Krisenzeiten versuchen Arbeitgeber manchmal unliebsame Arbeitnehmer über schikanöses Verhalten, organisatorischen Druck, besondere Belastungen und durch Abmahnungen zu Eigenkündigungen zu bewegen, um diese loszuwerden!
Das Betriebsräte hier nicht untätig zuschauen müssen, zeigt dieser Fall.
I. Das war der Fall
Ein Mitarbeiter, Assistenz des Betriebsrates, erhielt eine Abmahnung, weil er sich entgegen einer Anweisung der Personalabteilung nicht bei dieser, sondern ausschließlich beim Betriebsratsvorsitzenden wegen einer Arbeitsunfähigkeit abgemeldet hatte. Diese Abmahnung wollten weder der Mitarbeiter noch der Betriebsrat einfach hinnehmen.
II. Reaktion des Betriebsrates
Dem Mitarbeiter verbleibt hier nur die Möglichkeit, individualrechtlich auf Entfernung der Abmahnung zu klagen. Dies führt oft zu einer zusätzlichen Belastung des Arbeitsverhältnisses.
Deswegen kann der Betriebsrat unterstützend tätig werden und unter bestimmten Voraussetzungen sogar die Einigungsstelle anrufen. Genau das tat der Betriebsrat hier richtigerweise. Auch wenn er im konkreten Fall im Ergebnis im Verfahren unterlag, macht der Fall deutlich, wie der Betriebsrat „Rechtsschutz gewähren kann“.
III. Behandlung Abmahnungen als Beschwerden (§ 85 BetrVG)
Eine Abmahnung ist eine personelle Einzelmaßnahme. Sie ist mitbestimmungsfrei. Auch § 102 BetrVG findet auf Abmahnungen nach Ansicht der Rechtsprechung keine Anwendung.
a. Einleitung der Beschwerde
Dennoch kann ein Mitarbeiter sich jederzeit beim Betriebsrat beschweren. Dies kann im Zusammenhang mit Abmahnungen, bei Ermahnungen oder auch dann, wenn der Mitarbeiter sich unfair behandelt fühlt, geschehen. Der Mitarbeiter kann sich zunächst an die zuständige Stelle des Betriebes unter Hinzuziehung des Betriebsrates wenden (§ 84 BetrVG) oder die Beschwerde direkt an den Betriebsrat richten (§ 85 BetrVG). Die Entscheidung steht dem Mitarbeiter frei.
b. Einvernehmlicher Einigungsversuch (§ 85 Abs. 1 BetrVG)
Der Betriebsrat hat bei jeder Beschwerde eines Arbeitnehmers das Recht, sich der Beschwerde anzunehmen und beim Arbeitgeber auf Abhilfe hinzuwirken. Dies gilt für alle Fälle, in denen Mitarbeiter sich ungerecht behandelt fühlen, auch über ihrer Einschätzung nach zu Unrecht ausgesprochene Abmahnungen.
Zu dem Recht des Betriebsrates, auf Abhilfe hinzuwirken, gehört das Recht, mit dem Beschwerdeführer, weiteren betroffenen Mitarbeitern, dem Vorgesetzten und evtl. der Schwerbehindertenvertretung, einer betrieblichen Ombudsstelle und weiteren Personen Gespräche zu führen.
Der Betriebsrat hat auch das Recht, in den Monatsgesprächen mit dem Arbeitgeber den Vorfall zu thematisieren und auf einen Austausch zu bestehen. In diesen Gesprächen hat der Betriebsrat nicht nur das Recht, über die Berechtigung der Beschwerde zu sprechen, sondern auch konkrete Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen (Umsetzung des Vorgesetzten, Entlastung des Betroffenen etc.).
Bis hierhin (§ 85 Abs. 1 BetrVG) können die Betriebsparteien das Verfahren informell gestalten. Es ist ausschließlich auf eine einvernehmliche Einigung angelegt. Es kann (und sollte) auch eine Betriebsvereinbarung zum Umgang mit Beschwerden abgeschlossen werden.
c. Anrufung der Einigungsstelle (§ 85 Abs. 2 BetrVG)
Scheitert eine einvernehmliche Einigung, hält der Betriebsrat die Beschwerde jedoch für begründet, so kann er die Einigungsstelle anrufen (§ 85 Abs. 2 BetrVG).
Die Zuständigkeit der Einigungsstelle ist nur dann ausgeschlossen, wenn Gegenstand der Beschwerde ein individualvertraglicher Rechtsanspruch des Mitarbeiters ist. Diese Eingrenzung ist aus zwei Gründen sehr einschränkend auszulegen.
Erstens ist der Arbeitgeber zu einem fairen und gerechten Umgang aus seiner arbeitsvertraglichen Nebenpflicht gegenüber jedem Mitarbeiter verpflichtet (§ 241 Abs. 2 BGB). Jeder Arbeitnehmer hat damit einen arbeitsvertraglichen Rechtsanspruch darauf, fair behandelt zu werden. Es können somit nicht alle Rechtsansprüche ausgeschlossen sein, dann bliebe für die Beschwerde nichts übrig. Die Zuständigkeit der Einigungsstelle ist nach überwiegender Rechtsprechung in solchen Fällen bereits dann begründet, wenn ein Vorgesetzter einen einzelnen Mitarbeiter bevorzugt behandelt und anderen Mitarbeitern Rechte (Lohnzahlung, Zulagen, Prämien, Beförderungen etc.) vorenthält. Behandelt ein Vorgesetzter einzelne Mitarbeiter gezielt schlechter, genügt es, wenn über einen Einzelfall hinaus eine systematische Benachteiligung/Schikane/Mobbing etc. zu vermuten ist. Typisch hierfür sind solche Fälle, in denen besonders unangenehme Arbeiten, ungünstige Dienstplaneinteilungen oder unbeliebte Urlaubszeiten stets demselben Mitarbeiter zugewiesen werden. Dies genügt für die Vermutung einer systematischen Benachteiligung.
Zweitens prüft das Gericht die Zuständigkeit der Einigungsstelle nur in einem Schnellverfahren. Es darf diese nur verneinen, wenn die Einigungsstelle „offensichtlich unzuständig“ ist (§ 100 ArbGG).


Fatale Fehleinschätzungen
Irrtümer und Aberglauben im Arbeitsrecht
Wenn ich krank bin, kann mir nicht gekündigt werden.
Falsch.
Die Krankheit an sich schützt nicht vor Kündigung. Es ist zwar möglich, dass die krankheitsbedingte Kündigung unwirksam ist, das muss aber separat geprüft werden.
Wenn ich krank bin, muss ich Zuhause bleiben.
Falsch.
Es kommt immer auf die Diagnose an. Man darf sich nur nicht genesungswidrig verhalten.
Teilzeitbeschäftigte haben einen geringeren Urlaubsanspruch
Das kommt darauf an.
Der Urlaubsanspruch bemisst sich nach der Anzahl an Tagen/ Woche, an denen man arbeitet. Arbeitet man Teilzeit, aber an 5 Tagen/ Woche, hat man genauso viele Tage Urlaub wie ein Vollzeitbeschäftigter.
Urlaub kann immer aufs Folgejahr übertragen werden, wenn man dies braucht.
Falsch.
Das Bundesurlaubsgesetz sieht vor, dass der Urlaub im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden muss.
Eine Übertragung auf das Folgejahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Übrigen kommt es auf die betrieblichen Regelungen zu den Urlaubsgrundsätzen an. Diese unterliegen der Mitbestimmung des Betriebsrats. Der Arbeitgeber muss Arbeitnehmer ausdrücklich darauf hinweisen, dass sie noch offenen Urlaub haben, der ggf. verfällt, wenn er nicht genommen wird.
Der Betriebsrat kann individuelle Ansprüche von Mitarbeitern durchsetzen.
Falsch.
Der BR kann nur kollektive Ansprüche durchsetzen. Das Bundesarbeitsgericht geht davon aus, dass Beschäftigte die ihnen zustehenden individuellen Ansprüche selbst gerichtlich erstreiten müssen.
Ein Beschlussverfahren durch den Betriebsrat, mit dem individuelle Ansprüche durchgesetzt werden sollen, wird als unzulässig abgewiesen.
Bei Kündigung habe ich immer einen Anspruch auf Abfindung.
Falsch.
In Deutschland gibt es keinen gesetzlichen Anspruch auf Abfindung. Es gibt lediglich die
Abfindung beim Auflösungsantrag bei der Kündigung von Geschäftsführern. Abfindungen sind daher Verhandlungssache und hängen maßgeblich von der Erfolgsaussicht des Kündigungsschutzprozesses ab!
Nur in Betrieben mit Betriebsrat hat der Arbeitgeber die Pflicht bei einer
Betriebsänderung einen Sozialplan aufzustellen. Aus dem Sozialplan haben die Gekündigten einen Anspruch auf eine Abfindung. ABER: Ohne Betriebsrat kein Sozialplan!
Es braucht immer drei Abmahnungen, bevor eine Kündigung ausgesprochen werden darf.
Falsch.
Zeigt sich nach einer berechtigten Abmahnung ein kündigungsrelevantes Wiederholungsverhalten, kann auch schon nach einer Abmahnung die Kündigung erfolgen.
Erfolgen zu viele Abmahnungen aus demselben Sachzusammenhang stellt sich der Arbeitgeber selbst ein Bein. Denn die Warnfunktion wird erheblich geschwächt, wenn der AG bei ständig neuen Pflichtverletzungen des AN stets nur mit Kündigung droht, ohne jemals die angedrohten
Konsequenzen folgen zu lassen.
Eine Abmahnung ist entbehrlich, wenn der AN zu erkennen gegeben hat, dass er nicht willens oder nicht in der Lage ist, sich vertragsgetreu zu verhalten.
Am Besten immer den Betriebsrat oder die Gewerkschaft fragen, was ihr unternehmen könnt.

Kolumne „Fragen zum Arbeitsrecht“
Fragen und Antworten rund ums Arbeitsrecht
Die Leserinnen und Leser der Tageszeitung „Tagesspiegel“ kennen DGB-Arbeitsrechtsexpertin Marta Böning. Sie beantwortet auf der Karriere-Seite Fragen zum Arbeitsrecht. Hier können Sie die Beiträge nach ihrem Erscheinen im Tagesspiegel online nachlesen. Heute: Marta Böning erklärt, was passiert, wenn Beschäftigte bis zum Jahresende nicht ihren gesamten Urlaub nehmen können.

Personalgespräche – Wann ist der Betriebsrat dabei?
„Kommen Sie doch mal in mein Büro“
Nahezu alle Beschäftigten sind schon einmal mit der Situation konfrontiert worden, schnell zu einem Gespräch mit dem Vorgesetzten oder der Personalabteilung bestellt zu werden. Aber muss ich allein dorthin oder darf ich ein Mitglied des Betriebsrats mitnehmen?
Die Gründe, zu einem Personalgespräch gebeten zu werden, können vielfältig sein: von harmlos bis aber auch sehr unangenehm. Die Bandbreite der Themen kann von der positiven Mitteilung der Gehaltsentwicklung über Fragen zur Qualifikation hin zur Änderung von Arbeitsbedingungen, Krankenrückkehrgesprächen, dem Unterbreiten eines Aufhebungsvertrags bis hin zu Befragungen im Rahmen von Compliance-Untersuchungen reichen.
Besteht eine Verpflichtung an Personalgesprächen teilzunehmen?
Es kommt darauf an, ob der Arbeitgeber die Teilnahme am Gespräch im Rahmen seines Weisungsrechts nach § 106 Gewerbeordnung (GewO) anordnen kann. Das arbeitgeberseitige Direktionsrecht beschränkt sich auf Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung sowie auf die Ordnung und das Verhalten im Betrieb. In diesem Rahmen kann der Arbeitgeber Arbeitnehmende auch zur Teilnahme an Gesprächen verpflichten, in denen er Weisungen vorbereiten, erteilen oder ihre Nichteinhaltung beanstanden will.
Weigern sich Beschäftigte an solchen Gesprächen teilzunehmen, riskieren sie eine Abmahnung und im Wiederholungsfall ggf. eine Kündigung. Aber: Es besteht keine Verpflichtung des Arbeitnehmers, zu jedwedem Gespräch mit dem Arbeitgeber zur Verfügung zu stehen. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat z. B. eine Verpflichtung zur Teilnahme an einem Personalgespräch für den Arbeitnehmer verneint, in dem es ausschließlich um Verhandlungen mit dem Ziel einer Vertragsänderung gehen sollte. Auch wenn es um die Vertragsbeendigung geht, muss an dem Gespräch nicht teilgenommen werden. Beschäftigte sind auch nicht verpflichtet, an Gesprächen mit schikanösem Charakter oder außerhalb der Arbeitszeit teilzunehmen. Gleiches gilt grundsätzlich auch für die Dauer einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit. Im Krankheitsfall kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nur dann zu einem Gespräch anweisen, wenn hierfür ein dringender betrieblicher Anlass besteht, der einen Aufschub der Weisung auf einen Zeitpunkt nach Beendigung der Arbeitsunfähigkeit nicht gestattet und die persönliche Anwesenheit des Arbeitnehmers im Betrieb dringend erforderlich ist und ihm zugemutet werden kann.
Keine Teilnahme bei Verletzung von Mitbestimmungsrechten.
Die Wahrung von Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats ist ebenfalls für die Wirksamkeit der Anordnung von bestimmten Gesprächen gegenüber Beschäftigten von Bedeutung. An Gesprächen, die der Mitbestimmung des Betriebsrats unterfallen, wie z. B. formalisierte Krankenrückkehrgespräche, muss der Arbeitnehmer nicht teilnehmen, wenn diesbezüglich die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats nicht gewahrt wurden. Dies folgt aus der sogenannten Theorie der Wirksamkeitsvoraussetzung. Bei Bestehen von Mitbestimmungsrechten sind einseitige Anweisungen des Arbeitgebers dem Arbeitnehmer gegenüber unwirksam und müssen von diesem nicht befolgt werden.
Wann kann ein Betriebsratsmitglied hinzugezogen werden?
Gerade bei Gesprächen zu unangenehmen Themen wünschen sich Beschäftigte diese nicht allein führen zu müssen und wollen ein Betriebsratsmitglied hinzuziehen. Ein genereller Anspruch der Arbeitnehmenden darauf, bei jedem mit dem Arbeitgeber geführten Gespräch ein Betriebsratsmitglied hinzuzuziehen, folgt aus dem Betriebsverfassungsgesetz jedoch nicht. Die §§ 81 Abs. 4 Satz 3, 82 Abs. 2 Satz 2, 83 Abs. 1 Satz 2 und 84 Abs. 1 Satz 2 BetrVG regeln das Recht von Beschäftigten auf Hinzuziehung eines Betriebsratsmitglieds nur bezogen auf bestimmte Gegenstände und Anlässe. Hinzu kommen Gespräche im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagement nach § 164 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) IX. Das Recht der Beschäftigten nach § 82 Abs. 2 Satz 2 BetrVG ist begrenzt auf Gespräche über die in § 82 Abs. 2 Satz 1 BetrVG genannten Gegenstände, also wenn es um die Erläuterung der Berechnung und der Zusammensetzung des Arbeitsentgelts geht oder um die Erörterung der Beurteilung ihrer/seiner Leistungen sowie um die Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung im Betrieb. Ausreichend ist dabei, wenn die Gesprächsgegenstände zumindest teilweise identisch mit den in § 82 Abs. 2 Satz 1 BetrVG genannten Themen sind. Nicht erforderlich ist daher, dass es sich ausschließlich um die in § 82 Abs. 2 Satz 1 BetrVG genannten Gegenstände handelt. Weitere Gesprächsgegenstände, bei welchen die Hinzuziehung geregelt ist, sind z. B., wenn es über die Planung von künftigen Änderungen der Arbeitsabläufe und des Arbeitsplatzes geht, die Einsichtnahme in die Personalakte oder um eine Beschwerde gegenüber dem Arbeitgeber.

Beschäftigte sind bei der Auswahl des Betriebsratsmitglieds frei
Besteht Anspruch auf Hinzuziehung eines Betriebsratsmitglieds, sind Beschäftigte bei der Auswahl des Mitglieds frei. Dem Arbeitnehmer soll es möglich sein, gerade ein Mitglied seines Vertrauens hinzuzuziehen. Ist das entsprechende Betriebsratsmitglied vorübergehend nicht im Betrieb, ist das Personalgespräch zu verschieben.
Keine Hinzuziehung des Betriebsrats gegen den Willen des Arbeitnehmenden
Zu beachten ist, dass die Hinzuziehung eines Betriebsratsmitglieds dem Willen des Beschäftigten entsprechen muss. Sieht eine Betriebsvereinbarung vor, dass ein Personalgespräch zu einem vorgeworfenen Fehlverhalten nur unter gleichzeitiger Ladung von Beschäftigtem und Betriebsratsmitglied geführt werden darf, so verstößt diese gegen § 75 Abs. 2 BetrVG und ist unwirksam. Dennoch ist es grundsätzlich zulässig, auch im Rahmen von Betriebsvereinbarungen die Möglichkeit der Hinzuziehung von Betriebsratsmitgliedern für die Beschäftigten zu regeln.
Immer nach dem Anlass des Gesprächs fragen!
Damit Beschäftigte nun entscheiden können, ob sie ein Betriebsratsmitglied hinzuziehen wollen bzw. sie einen Anspruch darauf haben, sollten sie bei der Ankündigung von Personalgesprächen immer nach Anlass und Thema fragen. Auch eine Rückfrage beim Betriebsrat, z. B. bezüglich bestehender Mitbestimmungsrechte zum Gesprächsgegenstand ist zu empfehlen.

